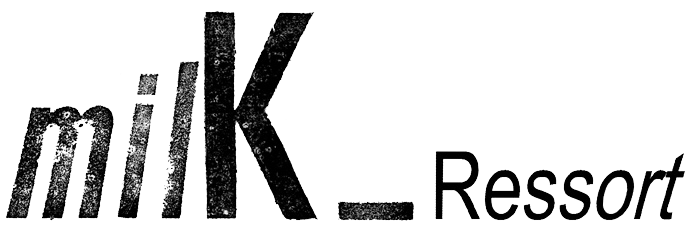Eröffnung: Freitag 20. September 2024 / 19 Uhr
Dauer: 3. November 2024
Öffnungszeiten: jeweils sonntags von 14 – 17 Uhr
Mit Werken von:
Dietmar Fend / HGfader / Lisa Krabichler / Leopold Kogler / Ch.Lingg / Martin Lohnicky / Arno Popotnig / Wolfgang Seierl / Uta Belina Waeger / Irmgard Welte / Albrecht Zauner
Das unvollendete Kunstwerk ist nicht ausschließlich ein Phänomen der Moderne, obwohl es in der modernen und zeitgenössischen Kunst besondere Aufmerksamkeit erhalten hat. Gültig ist, ein Meisterwerk muss nicht unbedingt vollendet sein, doch ist es dann noch ein Meisterwerk?
In der Musik ist das unvollendete reativ oft anzutreffen. Mozart hat fast 100 Werke unvollendet gelassen, darunter sein berühmtes Requiem. Schubert und Bruckner haben ihre großen Sinfonien auch nicht fertig geschrieben. Einige Kompositionen, die lediglich als Fragment hinterlassen wurden, sind aus den Spielplänen der Konzertsäle und Opernhäuser nicht wegzudenken. Im Laufe der Rezeptionsgeschichte wurde stets mit wechselndem Zeitgeist die Einschätzung des Fragmentarischen im Musikbetrieb auf die Spitze getrieben. Es gibt es genügend Beispiele unvollendeter Werke in verschiedenen Epochen der Geschichte der bildenden Kunst. Berühmte Werke wie Michelangelos “Sklaven” oder Leonardo da Vincis “Anbetung der Könige” blieben aus verschiedenen Gründen unvollendet. Oft aus praktischen Gründen wie dem Tod des Künstlers oder finanziellen Problemen. In der Moderne jedoch hat das Unvollendete eine neue Bedeutung und aber doch nur zögerliche Wertschätzung erfahren.
Künstler des 20. und 21. Jahrhunderts, wie etwa Pablo Picasso oder Jackson Pollock, haben das Konzept des Unvollendeten bewusst in ihre Werke integriert, um Prozesse, Bewegungen und den kreativen Akt selbst zu betonen. Robert Rauschenbergs „Erased Willem de Kooning“, war ja die provokante Rückführung eines fertigen Kunstwerkes in „unvollendetes Werk“. Welchen Grund anhand des unvollendet gebliebenen „Fräulein Lieser“ von Gustav Klimt, anliegt ist nicht überliefert.
Das Unvollendete kann per se hier als ein Ausdrucksmittel dienen, das die Flüchtigkeit und die fortlaufende Natur der Kreativität und der Wahrnehmung widerspiegelt. Auch das Spontane / Direkte des Mal-und Schaffungsaktes kommt so zur Geltung.
Oder doch nur ein profanes Innehalten des Künstlers? Eine Pause?
Oft wurde versucht, im Unvollendeten die tatsächliche Vollendung zu finden, die letzten Geheimnisse aus den großen Meisterwerken herauszukitzeln, ungelöste Rätsel zu dechiffrieren. Doch worin liegt eigentlich der Zauber des Fragmentarischen, diese Magie des „was-wäre-wenn“?
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Phänomen des unvollendeten Kunstwerks eine lange „Tradition“ hat, die weit in die Kunstgeschichte zurückreicht, aber selten in Form einer Ausstellung aufgezeigt wurde. hgfader